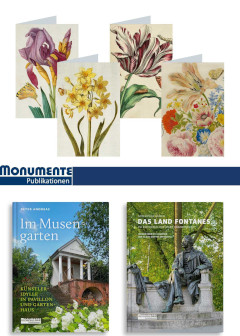St. Severi-Kirche
Otterndorf, Niedersachsen
St. Severi-Kirche
Schöner Klang im Orgel-Land
Dörfer und Gemeinden im niedersächsischen Marschland dürfen sich Jahr für Jahr über zahlreiche Gäste aus Europa und Übersee freuen. Das Augenmerk eines Teils der Besucher liegt dabei nicht auf der reizenden Landschaft des Wattenmeers, es sind die Dorfkirchen, die als Denkmale einen regen Zulauf haben - unter Orgelliebhabern und -musikern genießt die Region Weltruhm. Seit dem 15. Jahrhundert stifteten die wohlhabenden Bewohner der Nordseeküste kostbare Ausstattungsstücke für ihre Gotteshäuser. Als Nahrungsmittellieferanten von Städten wie Hamburg und Bremen reich geworden, beauftragten die Hofbesitzer und Kaufleute namhafte Künstler und Handwerker mit dem Bau kunstvoller Orgeln. Der berühmte Orgelbauer Arp Schnitger (1648-1719) hinterließ in diesem Landstrich zahlreiche Arbeiten. Unter seinem Einfluss stand auch Dietrich Christoph Gloger (1705-73), der dem Orgelbaustil Schnitgers in klanglicher wie technischer Hinsicht folgte. Auch die Orgel der im Kern mittelalterlichen Kirche St. Severi in Otterndorf stammt aus der Werkstatt Glogers. Das barocke Instrument ist ein fast 300 Jahre altes Kunstwerk und die größte Orgel ihrer Art zwischen Weser und Elbe.
Ein komplexes Instrument
1741/42 wurde die Orgel von Dietrich Christoph Gloger in die damals gerade umgestaltete Backsteinkirche eingebaut. Hierbei integrierte Gloger gut erhaltenes Material aus den Vorgängerwerken. So sind bis heute wertvolle Pfeifen aus dem 16. und 17. Jahrhundert vorhanden, ein Schatz von hohem Seltenheitswert! Die Gloger-Orgel beeindruckt nicht nur durch ihr Äußeres, den großen, symmetrisch aufgebauten Orgelprospekt mit seinem aufwändigen Schnitzwerk. Auch im Inneren setzt sich die meisterhafte Handwerkskunst fort. Hier befindet sich die ganze technische Anlage: der Blasebalg, der den Luftdruck produziert; die Windlade, die die Luft speichert und verteilt, und die Traktur, die bei Druck auf Tasten und Pedal ein Ventil öffnet und Luft in die jeweilige Pfeife strömen lässt. Die Orgel verfügt über drei Manuale und besitzt insgesamt 46 Register, Gruppen von Pfeifen mit gleicher Klangfarbe. Manche tragen die Namen alter, fast vergessener Blasinstrumente wie Bartpfeife, Gemshorn oder Dulcian. Insgesamt 2.676 Pfeifen, die in Etagen hinter- und übereinander stehen, ermöglichen ein beeindruckendes Klangbild.Es ist weniger das Alter der Gloger-Orgel, das für die vielen Probleme sorgt. Die Gründe liegen vor allem in den misslungenen Überarbeitungen des 20. Jahrhunderts. Sichtbar werden die Probleme besonders dann, wenn man hinter den prächtigen barocken Prospekt schaut und in das Musikinstrument hineinklettert.Ein Umbau mit Langzeitfolgen
1936 baute man zusätzliche Töne im Pedal ein und sortierte die Register neu. Allein tausend Pfeifen stammen noch aus der Renaissance- und Barockzeit. Um den neuen Pfeifen Platz zu machen, wurden die historischen Pfeifen umgestellt und gänzlich verändert: Sie wurden verkürzt, mit falschem Material verlängert und dilettantisch repariert. Heute stehen sie so eng, dass der Ton nicht genug Raum hat, um sich zu entfalten. Jenseits vieler oberflächlicher Schäden an Gehäuse und Spieltisch besteht darüber hinaus substanzielle Gefahr für die gesamte Orgel: Die komplette Konstruktion ist instabil, weil tragende Teile des Gehäuses 1936 entfernt wurden. Schimmelpilz hat sich im Inneren des Instruments breit gemacht und Materialien wie Holz und Leder befallen. Problematisch sind auch die vielfach verwendeten Kunststoffkleber, die sich zunehmend zersetzen und die historische Substanz angreifen. Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz hat die Sanierung der Orgel unterstützt, damit sie wieder schön erklingen kann.Das könnte Sie auch interessieren
Die ältesten Teile des Bauerndoms stammen aus der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts. Der Chor wurde 1585 angebaut. Bauliche Verändungen aus der Zeit von 1739/40. Förderungen 2019, 2021, 2022
Adresse:
Himmelreich
21762 Otterndorf
Niedersachsen