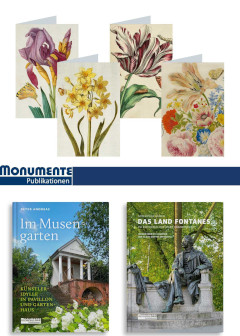Hospital St. Andreas
Großengottern, Thüringen
Hospital St. Andreas
Krankenhaus des 14. Jahrhunderts
St. Andreas war in Großengottern, Thüringen immer ein Ort der Heilung und Nächstenliebe, auch wenn die Kranken unter einfachsten Bedingungen auf gemauerten Steinliegen ruhten. Die Gebäude waren zwar einfach, aber die Pflege und die annähernd hygienischen Bedingungen standen im Vordergrund - mit abwechslungsreicher Kost und vielen Gebeten.
Anfangs Leprastation, später auch Altersheim
Der Mülverstedter Konvent des Wilhelmitenordens erwarb in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts ein Grundstück in Großengottern, um hier ein Hospital einzurichten. Aus dieser Anlage ging vermutlich um 1347 die Dorfkapelle St. Andreas hervor. Im 15. Jahrhundert wird das Spital als „Leprosenhaus“ bezeichnet; es war eines der 39 Leprosorien, die bisher in Thüringen bekannt sind. Die Anlage wurde im 18. und 19. Jahrhundert durch Umbauten weiter verändert. Mit dem Rückgang der Lepra wurde das Spital, im Volksmund „Spittel“ genannt, immer mehr ein Haus für Bedürftige und andere Kranke. Vermutlich lebten dort auch sogenannte Pfründner, die sich einkauften, um im Alter versorgt zu sein. St. Andreas war also wahrscheinlich auch ein Altersheim und Armenstift. Bis in die 1960er Jahre war das historische Hospital bewohnt, dann bis 1990 das erste ländliche Heimatmuseum im Kreis. Es folgten Leerstand und schleichender Verfall. Die Kapelle, der eingeschossiger Fachwerkbau mit Satteldach und acht Schlafkammern hatten schwer gelitten. Dächer, Hölzer und Bodenschwellen waren von Feuchte und Fäulnis angegriffen, lose Gefache drohten herauszubrechen.Museum zur Geschichte des Kranken- und Pflegewesens geplant
ein Museum zur Geschichte des Kranken- und Pflegewesens. Original erhaltene Schaustücke sollen Geschichte begreifbar machen. Zwischen 2014 und 2017 stellte die Stiftung kontinuierlich Mittel in insgesamt sechsstelliger Höhe für die Instandsetzung des Fachwerks und der Dächer an zwei Nebengebäuden des Hospital-Ensembles zur Verfügung.Das könnte Sie auch interessieren
1347 gestiftete Spitalanlage mit Hospizgebäude in Fachwerk und Bruchsteinkapelle aus dem 14./15. Jh., Förderung 2014-17, 2020, 2021, 2022, 2023
Adresse:
Langensalzaer Str.
99991 Großengottern
Thüringen